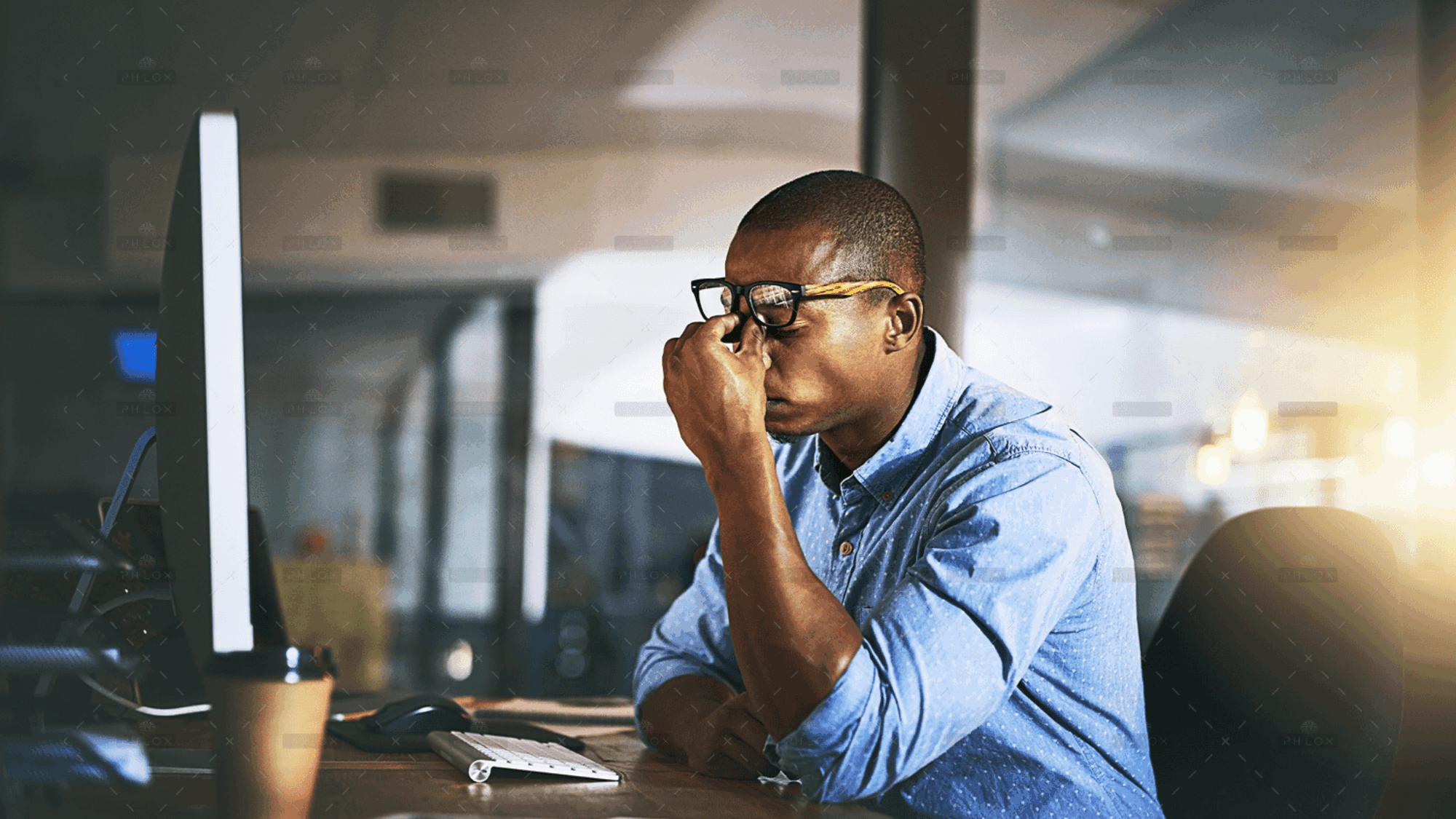„Psychotherapie“ kommt aus dem Altgriechischen und setzt sich zusammen aus den Wörtern „Psyche“ – Seele und „Therapeia“ – Behandlung. Die Behandlung setzt am Denken, Verhalten und Erleben des kranken Menschen an. Entscheidend ist, dass eine psychische Störung mit Krankheitswert vorliegt.
Unter den Behandlungsansatz fallen einerseits psychische Erkrankungen und Störungen wie etwa Ängste, Zwänge, Phobien, Essstörungen und Depressionen, psychiatrische Erkrankungen wie Psychosen, Demenzen und Süchte sowie psychosomatische Krankheiten, bei denen körperliche Beschwerden durch psychische Faktoren hervorgerufen werden. Schließlich bedürfen auch chronisch-physische Erkrankungen einer psychotherapeutischen Mitbehandlung.
Psychotherapeutische Ansätze und Richtungen sind vielfältig und auch vielschichtig. Es ist im Einzelfall im Gespräch mit dem Psychotherapeuten oder der Psychotherapeutin zu entscheiden, welche Methode am meisten Erfolg verspricht. Im Laufe der Zeit hat sich das Verhältnis von Therapeut und Patient gewandelt. Das traditionelle Bild – aktive Therapeuten machen etwas an passiven Patienten – ist überholt; heute versuchen beide eher, zusammen zu arbeiten, der leidende Mensch hat eine deutlich engagiertere Rolle.
Für Psychotherapeuten gelten spezifische fachliche und ethische Regeln. Sie unterliegen einer strengen Schweigepflicht, sind verpflichtet, Indikationen abzuklären und ihre Arbeit mittels Supervision zu reflektieren.
Wir bieten aktuell zwei unterschiedliche psychotherapeutische Ansätze an
- Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie nach C. G. Jung. Bei dieser Art der Therapie geht es um die Erkennung und Aufarbeitung von Komplexen, die den Menschen emotional beeinträchtigen und unser Verhalten unbewusst steuern. Komplexe sind im Unbewussten gespeicherte verinnerlichte konflikthafte Erfahrungen in Beziehungen, die mit einer oder mehreren schwierigen Emotionen – z.B. Angst, Wut, Scham – einhergehen, weshalb C. G. Jung auch von „gefühlsbetonten Komplexen“ spricht. Die Konflikterfahrungen wurden meist in der vulnerablen Phase der Kindheit gemacht, in einer Situation, die mit einem starken Gefühl einherging. Diese emotionsgeladenen Komplexe wirken als autonome Komplexe im Unbewussten weiter.
Frau Dr. Stehling-Al-Mahrazi hat analytische Psychologie am Forschungs- und Ausbildungsinstitut für Tiefenpsychologie nach Marie-Louise von Franz (Schweiz) unter der Supervision von Fr. Dr. Anne Maguire studiert.
Bücher: Dr. Anne Maguire
2- Verhaltenstherapie
Bei der Verhaltenstherapie steht nicht im Vordergrund, die Wurzeln einer Fehlentwicklung aufzudecken, sondern das aktuelle Verhalten und die Sichtweisen des Menschen zu untersuchen und bei Bedarf zu korrigieren. Die Verhaltenstherapie stützt sich dabei auf den Behaviorismus, die Theorie der Wissenschaft des menschlichen und tierischen Verhaltens.
Das Verhalten wird durch Lernen geformt, das heißt der Mensch lernt Regeln und macht Erfahrungen, die einen Einfluss auf sein Verhalten haben. Auf diese Weise können auch psychische Störungen aus Lernerfahrungen hervorgehen, die durch verhaltenstechnische Intervention wieder verlernt werden sollen. Ein wesentliches Kennzeichen verhaltenstherapeutischer Verfahren ist es, den Betroffenen zur Selbsthilfe anzuleiten und ihm Strategien zu vermitteln, die ihn in die Lage versetzen, seinen psychischen Problemen entgegenzutreten.